ES WAR IRGENDWANN in der Corona-Zeit, die auch ein Land wie Uganda erfasst hatte. Eines Tages bekam Veronica Biribawa mit, wie eine Frau sich auf ihr Grundstück geschlichen hatte. Die Sachlage war schnell klar: Ganz offensichtlich wollte die Frau heimlich Früchte aus ihrem Garten stehlen, Bananen und Mangos zum Beispiel. Veronica Biribawa ist Ordensschwester, das Gelände und der Garten gehört den „Evangelizing Sisters of Mary“. Die Schwestern sind großherzig, aber bestehlen lassen wollten sie sich trotzdem nicht. Der Wachmann sollte die Diebin fortjagen.
Kaum Strom und Wasser, kaum Toiletten oder Hygiene
Aber ich wollte dann doch wissen, was dahinter steckte
, sagt Schwester Veronica. Also folgte sie der Frau dorthin, wo sie hergekommen war. Und dann sah ich erst, wie diese Frauen leben müssen.
Masese, Abschnitt III, gilt als Slumviertel am Rande der Stadt Jinja. Der Begriff „Slum“ wird weiterhin verwendet, und alles andere würde die Lage nur beschönigen. Kaum Strom und Wasser, kaum Toiletten oder Hygiene, viele Frauen und Kinder, die auf der Straße leben. Illegale Schnapsbrennereien sind oft die wichtigste Geldquelle, und damit gehen Prostitution und Gewalt einher. Angelina Akoth lebt in Masese. Aus Hunger und Verzweiflung war sie damals den „Rubaga Hill“ hochgewandert und wollte sich auf dem Gelände der Schwestern heimlich im Garten bedienen.
 Das Slumviertel am Rande der Stadt Jinja
Das Slumviertel am Rande der Stadt Jinja
Doch was wie ein Kriminalfall begann, ist nun so etwas wie eine Geschäftsbeziehung geworden – oder vielleicht sogar eine Freundschaft. Denn die Ordensschwestern wollten helfen. Also stellten sie in Masese mehrere Frauengruppen zusammen – Frauen, die bereit waren, einen Neustart zu wagen. Sie sollten die Chance bekommen, mit etwas Startkapital eigene kleine Geschäfte aufzumachen und ihr eigenes Geld zu verdienen. Ein erster Schritt heraus aus der Armut und hinein in eine selbstbestimmte Zukunft. Wobei das mit dem „ersten Schritt“ nicht ganz stimmt, denn die meisten von ihnen hatten schon früher mehrere solche Schritte unternommen.
Der größte davon war, ihre ursprüngliche Heimatregion zu verlassen und hierher zu kommen. Viele stammen aus Karamoja, jene trockene Halbwüstenregion im Norden von Uganda, die seit Jahren und Jahrzehnten gebeutelt wird von Dürre und Hungersnöten. Es gab dort nichts: kein Regen, kein Essen, keine Schule. Also gingen wir weg
, sagt eine der Frauen. Heute haben sie sich getroffen, um zu zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gemeinsam erreicht haben. Schwester Veronica hört aufmerksam zu, als die Frauen noch einmal auf ihre Anfänge zurückblicken: Zur allgemeinen Notlage sei noch die schlimme Tradition der gegenseitigen Überfälle gekommen, bei denen sich verfeindete Gruppen gegenseitig ihre wertvollen Rinderherden rauben, oft bewaffnet mit Gewehren, was viele Todesopfer gerade unter den jungen Leuten fordert. Das trieb viele in die Flucht.
Viele Zuwanderer finden sich in Armut wieder
Ihr Ziel lag im Süden: Jinja, nicht weit vom Victoriasee gelegen, zählt zwar bevölkerungsmäßig nicht zu den größten Städten des Landes. Aber hier ist die zweitwichtigste Wirtschaftsregion (nach der Hauptstadt Kampala) entstanden. Viele Fabriken und Betriebe haben sich angesiedelt, von der Zuckerraffinerie bis zur Großbrauerei. Das zieht Menschen aus anderen Landesteilen an auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben.
Doch wer aus einem Gebiet wie Karamoja kommt, hat es nicht leicht. Zu unterschiedlich sind die Kulturen – es liegen Welten zwischen einem Leben als Halbnomaden am Rande der Wüste und der Arbeitswelt in der Industrie. Nur die wenigsten haben Lesen und Schreiben gelernt
, sagt Schwester Veronica. Und oft sprechen sie nur ihre eigene Sprache, die hier kaum jemand versteht.
Das macht es schwer, eine gut bezahlte Arbeit und ein Auskommen zu finden. Und so finden sich sehr viele Zuwanderer eben schnell in der Armut wieder und enden in einem Viertel wie Masese.
 Schwester Veronica mit Angelina Akoth, die jetzt selbstgemachte Briketts verkauft.
Schwester Veronica mit Angelina Akoth, die jetzt selbstgemachte Briketts verkauft.
Schwester Veronica und ihre Ordensgemeinschaft kennen Karamoja gut – die „Evangelizing Sisters of Mary“ wurden selbst in den 1970er-Jahren von italienischen Missionaren in Karamoja gegründet. Sie sollten den Benachteiligten beistehen und besonders Frauen und Mädchen fördern. Dieser Auftrag prägt sie bis heute – mit ihrem Programm in Masese erreichen sie inzwischen rund 500 Frauen. Schwester Veronica sagt: Wenn ich sehe, dass die Frauen glücklich sind, und dass sie genug zu essen haben, dann erfüllt mich das einfach mit Freude.
Wie bei Angelina Akoth. Ich verkaufe jetzt meine selbstgemachten Briketts
, erklärt sie. Brennholz und Holzkohle sind teuer, die Briketts aus Kompost, Asche und getrocknetem Kuhdung sind eine clevere Alternative. Ich kann für ein Päckchen immerhin 1000 Schilling einnehmen
, sagt Angelina Akoth. Das sind umgerechnet zwar nur knapp 25 Cent, aber es ist ein Anfang. Ich habe genug Kunden, weil meine Qualität stimmt.
Aus Angelina, die auf der Straße lebte und ihr Essen stehlen musste, ist eine Geschäftsfrau geworden. Ich freue mich, dass sie glücklich ist
, sagt Schwester Veronica, als sie sich für heute von ihr verabschiedet.
Die Zukunft ist alles andere als sicher
Die Ordensschwester will jetzt noch nach Aisha sehen – eine Frau, die sie ebenfalls schon eine Weile betreut. Aisha sitzt am Straßenrand, sie wäscht leere Plastikflaschen aus, damit man diese wiederverwenden kann. Wasserflaschen nehmen die Leute zum Beispiel, um Öl oder Benzin abzuzapfen. Die Frau erhält dafür etwas Geld. Doch sie ist an Diabetes erkrankt, und als Folge davon musste ihr das linke Bein abgenommen werden. Jetzt kann ich mich kaum noch richtig fortbewegen
, sagt sie. Klagen will sie nicht, obwohl die Probleme groß sind: Essen, Schulbildung für die Kinder, dazu eine Wohnung, und sei sie noch so klein – alles kostet Geld. Aus dem Hilfsprogramm der Schwestern ließ sich immerhin die Miete für fünf Monate finanzieren – fünf Monate mehr, die Aisha und ihre Kinder nicht auf der Straße leben mussten.
 Die Schwestern in Jinja unterstützen die Menschen im Slum Masese, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Die Schwestern in Jinja unterstützen die Menschen im Slum Masese, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Leider ist die Zukunft alles andere als sicher: Niemand weiß so genau, wem das Land eigentlich gehört, auf dem sie sich niedergelassen haben – auch wenn regelmäßig jemand kommt und Miete kassiert. Ein kleiner Verschlag aus Brettern, Lehm und Blech kann im Monat 100 000 Schilling kosten. Oft teilen sich deshalb zehn Leute oder mehr einen Schlafraum. Und oft genug kommt es vor, dass plötzlich neu gebaut werden soll, oder eine Straße erweitert wird – und dann müssen die provisorischen Hütten der Armen eben wieder weichen, und die Menschen suchen erneut nach einer Bleibe. Aber Schwester Veronica hat die Erfahrung gemacht: Gerade die Frauen sind alle sehr kreativ. Sie haben sehr viele Ideen für ihr Geschäft. Das wird sie auf alle Fälle vorwärtsbringen.
Ob sie nun Müll recyceln, Hühner und Schweine züchten oder Gemüse anbauen: die Hoffnung auf ein besseres Leben verbindet sie.







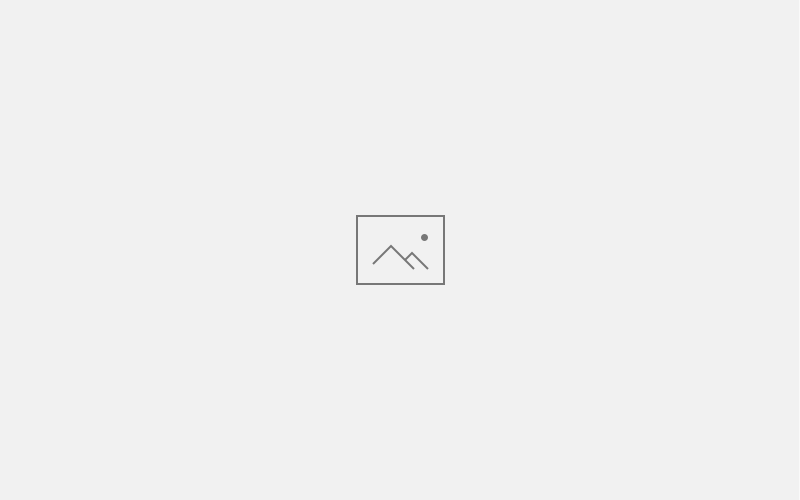




 Wenn die alten Römer vor einem Problem standen, das ihnen unlösbar erschien, dann benutzten sie folgende Redensart: Facilius sit Nili caput invenire – aus dem Lateinischen übersetzt: Es wäre leichter, den Ursprung des Nils zu finden. Über Jahrhunderte versuchten europäische Reisende, zur Quelle des längsten Stromes Afrikas vorzudringen. Meistens scheiterten sie am „Sudd“, jenem Sumpfgebiet im heutigen Südsudan, der weite Landstriche unüberwindbar macht. Den Menschen in Afrika war der Nil lange vor den Europäern ein Begriff. Doch auch in Afrika fand man erst im Lauf der Jahre heraus, aus welchen Armen der Nil sich speist, bevor er sich im Norden Ägyptens ins Mittelmeer ergießt.
Wenn die alten Römer vor einem Problem standen, das ihnen unlösbar erschien, dann benutzten sie folgende Redensart: Facilius sit Nili caput invenire – aus dem Lateinischen übersetzt: Es wäre leichter, den Ursprung des Nils zu finden. Über Jahrhunderte versuchten europäische Reisende, zur Quelle des längsten Stromes Afrikas vorzudringen. Meistens scheiterten sie am „Sudd“, jenem Sumpfgebiet im heutigen Südsudan, der weite Landstriche unüberwindbar macht. Den Menschen in Afrika war der Nil lange vor den Europäern ein Begriff. Doch auch in Afrika fand man erst im Lauf der Jahre heraus, aus welchen Armen der Nil sich speist, bevor er sich im Norden Ägyptens ins Mittelmeer ergießt.