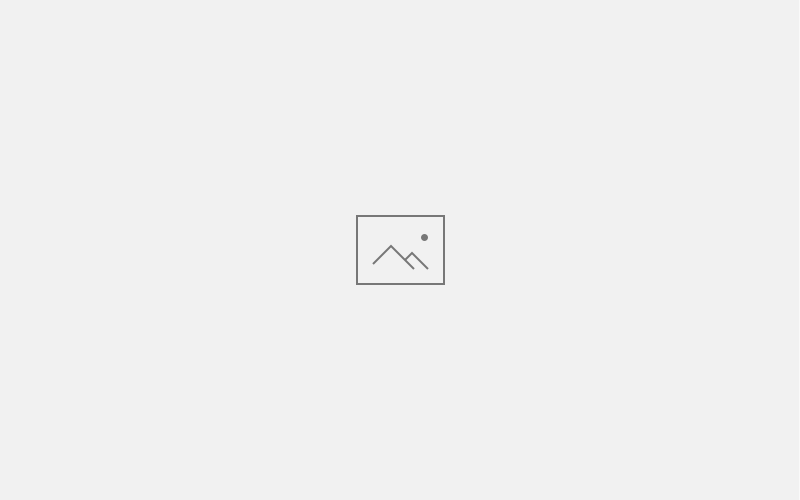ALS DER STICHTAG am 25. April 2024 gekommen war, rückten Polizei und Militär in das abgelegene Bergdorf Ganatan ein und zerstörten die Hütten von 32 Familien. 15 Tage zuvor hatte die indigene Gemeinschaft der Manobo die Aufforderung erhalten, ihr Land zu räumen. Es sei nun verkauft. Die Bewohner hatten kaum eine Chance. Auch ein letzter, verzweifelter Antrag auf Aufschub wurde abgelehnt. Als es dann soweit war, leisteten zwei Familien besonders Widerstand. Vergeblich. Sie sollten es erst recht zu spüren bekommen: Nachdem sie unter Protest und Tränen ihre Bleibe verlassen hatten, steckten die Uniformierten die einfachen Holzbauten in Brand und ließen die Flammen lodern, bis nichts mehr übrig war außer Asche.
Illegale Zerstörung von Häusern
 Alan Otti:
Alan Otti: Unsere Häuser wurden illegal zerstört.
Es ist das vorerst jüngste Ereignis einer langen und schmerzhaften Geschichte von Vertreibung und Ausgrenzung. Über ein Jahr später sitzt der Schock über das Erlebte noch immer tief. Wir haben Anzeige wegen der illegalen Zerstörung unserer Häuser erstattet
, sagt Dorfvorsteher Alan Otti. Das Problem sei nur, dass sie sich keinen richtigen Anwalt leisten könnten. Es ist sehr schwierig für uns
, fügt seine Frau Alma hinzu. Zu unseren Feldern dürfen wir auch nicht mehr – sie haben Zäune aufgestellt. Alles, was wir gepflanzt haben, ist verloren.
Die Manobo gehören zu den rund 20 indigenen Ethnien auf Mindanao – einer Insel, die aufgrund ihrer Rohstoffe und ihres Konfliktpotenzials oft als Krisenregion der Philippinen gilt. Fruchtbare Böden, Wasserquellen sowie große Gold- und Kupfervorkommen machen das Land bei Großgrundbesitzern und ausländischen Investoren begehrt. Staatlich geförderte Umsiedlungsprogramme haben die Lage zusätzlich verschärft. Besonders in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Menschen von den bevölkerungsreichen Inseln Luzon und den Visayas nach Mindanao umgesiedelt und mit Land ausgestattet. Dadurch entstand ein System von Kaufverträgen und schriftlichen Landtiteln – ein Konzept, dass sich die indigene Bevölkerung erst aneignen musste. Heute ist es für viele ohne solche Dokumente nahezu unmöglich, ihren jahrhundertealten Besitz nachzuweisen oder zu schützen.
Einsatz für Rechte der indigenen Bevölkerung
Unser Land ist alles, was wir haben – ohne Land sind wir nichts
, sagt Alma Otti. Seit 1997 sind die Rechte der indigenen Völker auf ihr angestammtes Land gesetzlich verankert, doch die Realität sieht häufig anders aus. Denn wer seine Rechte einfordert, lebt gefährlich. Zahlreiche indigene Anführer wurden bereits bedroht, als Staatsfeind gebrandmarkt oder getötet, weil sie sich dafür eingesetzt haben, ihr Land zurückzugewinnen – ein Land, das ihnen illegal und oft ohne Ankündigung genommen wurde
, sagt Jocelyn Aquiatan. Mit ihrer Organisation ICON-SP (Inter-Cultural Organizations’ Network for Solidarity & Peace) setzt sie sich seit über 15 Jahren für die Rechte der indigenen Bevölkerung auf Mindanao ein und fördert das friedliche Zusammenleben zwischen Christen, Muslimen und Indigenen.
 Die Angehörigen der Manobo-Ethnie wurden schon mehrmals vertrieben.Auch Alan Otti entging nur knapp einem Attentat. Auf dem Motorrad wurde er von einem anderen Fahrer überholt – der zog eine Waffe und schoss. Die Kugel verfehlte Alan Otti nur knapp. Seitdem lebt die Gemeinschaft in ständiger Angst, dass ihm irgendwann doch noch etwas zustoßen könnte. Heute leben die 34 Manobo-Familien auf einem Hektar Land, dass Alan Otti der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt hat. Für das Grundstück hat er sich inzwischen um einen offiziellen Landtitel bemüht – doch, ob sie diesmal bleiben dürfen? Wirklich sicher ist sich derzeit noch keiner. Trotz dieser Unsicherheit haben die Familien mit Unterstützung von ICON-SP damit begonnen, neue Häuser zu bauen – stabil, mit Ziegelfundamenten und festen Dächern aus Wellblech.
Die Angehörigen der Manobo-Ethnie wurden schon mehrmals vertrieben.Auch Alan Otti entging nur knapp einem Attentat. Auf dem Motorrad wurde er von einem anderen Fahrer überholt – der zog eine Waffe und schoss. Die Kugel verfehlte Alan Otti nur knapp. Seitdem lebt die Gemeinschaft in ständiger Angst, dass ihm irgendwann doch noch etwas zustoßen könnte. Heute leben die 34 Manobo-Familien auf einem Hektar Land, dass Alan Otti der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt hat. Für das Grundstück hat er sich inzwischen um einen offiziellen Landtitel bemüht – doch, ob sie diesmal bleiben dürfen? Wirklich sicher ist sich derzeit noch keiner. Trotz dieser Unsicherheit haben die Familien mit Unterstützung von ICON-SP damit begonnen, neue Häuser zu bauen – stabil, mit Ziegelfundamenten und festen Dächern aus Wellblech. Ich bin schon alt, war vier Mal verheiratet, aber in so einem Haus habe ich noch nie gelebt
, sagt einer der ältesten Bewohner. Die Gruppe von Frauen und Männern um ihn herum lacht – ein Moment, der zeigt, wieviel Widerstandskraft in dieser Gemeinschaft steckt.
Immer wieder von vorne anfangen zu müssen, das wünscht sich Marissa Ansabo für ihre Töchter und Söhne allerdings nicht. Ich hoffe, dass meine Kinder einmal ein besseres Leben führen können
, sagt sie. Die junge Mutter hat klare Vorstellungen: Ihre vier Kinder sollen später einmal Polizist, Anwalt, Krankenschwester und Ingenieur werden. Berufe, die wir hier gut gebrauchen können.
Das Gefühl der Entwurzelung bleibt.
Große Gefahr für Menschenrechtsaktivisten
Jocelyn Aquiatan besucht die Bewohner in Ganatan regelmäßig. Oft folgt ihr dabei das Militär, lässt sie wissen, dass ihre Schritte beobachtet werden. Jocelyn Aquiatan sowie alle anderen Mitarbeiter von ICON-SP sind Militär und Regierung bekannt. Sie gelten als „red-tagged“, als vermeintliche Sympathisanten kommunistischer oder terroristischer Gruppen – eine gängige Praxis, um Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger einzuschüchtern. Wir wissen, dass auch uns jeder Zeit etwas zustoßen kann
, sagt Jocelyn Aquiatan. Allein in den vergangenen sieben Jahren wurden auf Mindanao 98 Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten getötet – die Dunkelziffer dürfte jedoch noch höher liegen. Viele der Taten werden mit staatlichen oder paramilitärischen Kräften in Verbindung gebracht und selten vollständig aufgeklärt.
 Im Dorf San Vincente haben Angehörige der Bla’an-Ethnie ein neues Zuhause gefunden.Etwa zwei Autostunden von Ganatan entfernt, im Dorf San Vincente, zeigt sich, wie die neuen Unterkünfte der Manobo einmal aussehen könnten. Auf einer Lichtung, umgeben von dichtem Palmenwald, reihen sich solide Häuser aneinander. Über 400 Menschen – überwiegend Angehörige der indigenen Bla’an – haben hier mit Hilfe von ICON-SP ein neues Leben begonnen. Auch sie wurden mehrfach vertrieben – zuletzt lebten viele von ihnen auf einem Friedhof.
Im Dorf San Vincente haben Angehörige der Bla’an-Ethnie ein neues Zuhause gefunden.Etwa zwei Autostunden von Ganatan entfernt, im Dorf San Vincente, zeigt sich, wie die neuen Unterkünfte der Manobo einmal aussehen könnten. Auf einer Lichtung, umgeben von dichtem Palmenwald, reihen sich solide Häuser aneinander. Über 400 Menschen – überwiegend Angehörige der indigenen Bla’an – haben hier mit Hilfe von ICON-SP ein neues Leben begonnen. Auch sie wurden mehrfach vertrieben – zuletzt lebten viele von ihnen auf einem Friedhof. Nachts haben die Menschen auf den Gräbern geschlafen, tagsüber haben sie darauf gegessen
, sagt Marbelle Timpawa, die als Sprecherin der Dorfgemeinschaft gilt.
Doch trotz neuer Häuser bleibt das Gefühl der Entwurzelung. Wir haben kein Land mehr, auf dem wir selbst anbauen können
, sagt Marbelle Timpawa. Es ist sehr schwierig geworden, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen.
Es gibt Pläne, traditionelles Kunsthandwerk, Schmuck und Kleidung herzustellen und zu verkaufen. Doch auch dafür bräuchte es erst einmal ein Startkapital. Also bleibt den meisten nichts anderes übrig, als für wenig Geld auf fremden Feldern zu arbeiten.
Armut und Diskriminierung
 Jocelyn Aquiatan (links) wird im Monat der Weltmission im Oktober in Bayern unterwegs sein. Auch hier setzen Jocelyn Aquiatan und ihr Team an. Sie vergeben Stipendien an junge Leute aus indigenen Gemeinschaften, unterstützen sie bis zum Uniabschluss.
Jocelyn Aquiatan (links) wird im Monat der Weltmission im Oktober in Bayern unterwegs sein. Auch hier setzen Jocelyn Aquiatan und ihr Team an. Sie vergeben Stipendien an junge Leute aus indigenen Gemeinschaften, unterstützen sie bis zum Uniabschluss. Nach wie vor ist der Zugang zu Bildung für Indigene schwieriger als für andere
, sagt Jocelyn Aquiatan Armut spiele dabei eine große Rolle, aber auch Diskriminierung. In Columbio, im Süden der Insel, wo Minenarbeiten das einst klare Wasser des Dalol Flusses inzwischen kupferrot färben, leben 23 junge Stipendiatinnen und Stipendiaten in einem kleinen Wohnheim zusammen. Die meisten von ihnen gehören zu den Bla’an, aber auch ein paar Moro – wie sich die Muslime auf Mindanao nennen – sind dabei und ein paar Christen. Wir wollen benachteiligte Jugendliche fördern, aber auch Vorurteile zwischen den Bevölkerungsgruppen abbauen
, sagt Jocelyn Aquiatan, die an vielen Orten der Insel Projekte zum interkulturellen und religiösen Dialog ins Leben gerufen hat.
An diesem Nachmittag tanzen Mädchen und Frauen der Bla’an vor dem Wohnheim einen traditionellen Tanz in farbenfrohen Gewändern. Jocelyn Aquiatan tanzt mit – sie kennt jeden Schritt und jede Bewegung. Ein älterer Mann begleitet sie musikalisch auf einer Faglung. Das zweisaitige Musikinstrument ist eines der wichtigsten kulturellen Symbole der Bla’an. Der Kampf um Land ist das eine
, sagt Jocelyn Aquiatan, nachdem der Auftritt vorbei ist. Mindestens genauso wichtig aber sei es, die Kultur der Indigenen zu bewahren. Sie ist ein kostbarer Schatz unseres Landes.