 Die Comboni Klinik wird von der Kirche betrieben und steht allen Patienten offen.SIE HAT ES OFT GENUG selber mit angesehen. In ihrem Heimatdorf, wenn eine junge Mutter ein Kind zur Welt bringen sollte. Es gab Probleme, niemand wusste, was zu tun war, man hätte eine Ärztin gebraucht. Aber das nächste Krankenhaus war viel zu weit entfernt. Die Hilfe blieb aus, die Mutter musste sterben. Oder sie überlebte vielleicht, aber dafür konnte niemand das Kind retten. Wie oft hat Edia Atanasio dann bei sich gedacht:
Die Comboni Klinik wird von der Kirche betrieben und steht allen Patienten offen.SIE HAT ES OFT GENUG selber mit angesehen. In ihrem Heimatdorf, wenn eine junge Mutter ein Kind zur Welt bringen sollte. Es gab Probleme, niemand wusste, was zu tun war, man hätte eine Ärztin gebraucht. Aber das nächste Krankenhaus war viel zu weit entfernt. Die Hilfe blieb aus, die Mutter musste sterben. Oder sie überlebte vielleicht, aber dafür konnte niemand das Kind retten. Wie oft hat Edia Atanasio dann bei sich gedacht: Wie wäre es, wenn ich ihnen hätte helfen können?
So entstand ihr Berufswunsch, ihr Traum: Ich möchte Hebamme werden.
Als sie dann in der Schule die Ausschreibung sah für das „Catholic Health Training Institute“, bewarb sie sich. Jetzt ist die 23-Jährige mittendrin in der dreijährigen Ausbildung. Und gerade muss sie ihren Traum noch einmal überprüfen und sehen, ob er der harten Wirklichkeit standhalten kann. Die Studentin hat ihren ersten Einsatz in der katholischen Comboni-Klinik von Wau, der zweitgrößten Stadt im Südsudan. Das kleine Krankenhaus wird von der Kirche betrieben, es ist sehr schlicht ausgestattet, aber dennoch eine der besseren Adressen.
Frühgeborene im Brutkasten
 Schwester Bindu George:
Schwester Bindu George: Sobald sie ihren Abschluss haben, werden sie schnell Arbeit finden.
Ganz schön viel Trubel herrscht hier an diesem Morgen. Die ärztliche Visite hat schon begonnen, um den Arzt scharen sich Krankenschwestern und Pflegerinnen, und irgendwo mittendrin in der Menschentraube steht auch Edia Atanasio. Sie trägt einen weinroten Kittel und eine medizinische Maske. Sie soll den erfahrenen Kolleginnen zusehen und dabei möglichst viel lernen. Aber es ist gar nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten. Ich brauche eine Studentin bitte
, ruft eine andere Ärztin. An Bett 9 muss ein Katheter geleert werden. Und in Bett 10 liegt eine Frau, die nicht hören kann. Bett 8: Die Patientin kann nichts essen. Bett 11: Schwere Malaria. Und nebenan, auf der Station der Frühchen liegen die Kinder, die zu früh geboren wurden. Im Brutkasten werden sie versorgt. Ein Zwillingsmädchen hat überlebt, das zweite Kind ist gestorben. Damit sich das überlebende Kind nicht alleine fühlt, haben sie ein anderes Kind zu ihr ins Bett gelegt.
Welcome to this ocean of chaos
, sagt Dr. Bindu George zur Begrüßung. Als Ozean des Chaos
, so erscheint ihr die Arbeit in Wau ziemlich oft. Bindu George ist Ärztin, sie kommt aus Karnataka in Indien, hat dort am „St. John’s Medical College“ studiert, eine der besten Universitäten des Landes. Sie ist außerdem Ordensfrau und kam auf Mission nach Afrika. Ich wollte etwas dagegen tun, dass so viele Mütter sterben
, sagt sie. Doch erst einmal war sie selber mit einem Todesfall konfrontiert. Ihre Mitschwester starb an Covid-19. Plötzlich wurde sie gefragt, ob sie die Ausbildung junger Schwestern und Hebammenschülerinnen übernehmen würde. So betreut Sister Bindu George nun Studentinnen wie Edia.
Malaria, Lepra, Aids: Gut ausgebildete Spezialkräfte sind gefragt
Bindu George sagt: Krankenschwestern und Hebammen sind das Rückgrat unseres Gesundheitswesens. Die Studentinnen kommen aus allen Ecken des Landes zu uns.
Sie betont: Ich freue mich, wenn unsere Studentinnen im Leben vorwärtskommen und auch eines Tages hier im Südsudan arbeiten werden. Denn hier werden sie am meisten gebraucht.
Es gehört ja zu den großen Problemen in einem Land wie dem Südsudan, dass überall das geeignete Personal fehlt: zu wenig Ärzte, zu wenig Pflegekräfte. Und wenn es sie gibt, dann wandern sie in die Hauptstadt Juba ab, oder gleich ins Ausland, wo mehr bezahlt wird und das Leben weniger lebensbedrohlich scheint. Wer am „Health Institute“ studiert, verpflichtet sich, nach dem Abschluss für mindestens zwei Jahre in der Region zu bleiben und in einer kirchlichen Einrichtung zu arbeiten. Der Bedarf ist gewaltig, Dr. Bindu George hat es ja schon gesagt. Jedes Jahr hier kommt einem vor wie zehn Jahre.
 Learning by doing: Studentin Edia Atanasio misst den Blutdruck.Edia Atanasio folgt der Gruppe ins nächste Patientenzimmer. Schnell hat sie die ersten Handgriffe verinnerlicht. Eine Schlaufe um den Arm legen, den Schlauch aufpumpen, den Blutdruck ablesen. Sie trägt den Wert in eine Liste ein.
Learning by doing: Studentin Edia Atanasio misst den Blutdruck.Edia Atanasio folgt der Gruppe ins nächste Patientenzimmer. Schnell hat sie die ersten Handgriffe verinnerlicht. Eine Schlaufe um den Arm legen, den Schlauch aufpumpen, den Blutdruck ablesen. Sie trägt den Wert in eine Liste ein.
Hier im Südsudan sieht man Krankheiten in einem Stadium, wie wir es in Europa nicht mehr kennen
, sagt Tatjana Gerber. Sie arbeitet für die katholische Diözese von Wau und koordiniert die Gesundheitsprojekte der Kirche. Über zehn Jahre schon lebt sie im Südsudan. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und ging als Entwicklungshelferin von Hamburg nach Afrika. Mit ungewöhnlichen Einsatzorten kennt sie sich aus, denn schon ihre Mutter arbeitete im Waldkrankenhaus Wintermoor, eine Tuberkuloseklinik in der Lüneburger Heide, mitten in einem Wald.
Im Südsudan trifft Tatjana Gerber auf Krankheiten wie Malaria und HIV / Aids, an denen immer noch zu viele Menschen sterben. In der Siedlung Agok nahe Wau gibt es eine Kolonie von Menschen, die an Lepra erkrankt sind und mit den Spätfolgen zu kämpfen haben. Regelmäßig organisiert sie medizinische Hilfsaktionen, die über mehrere Tage gehen. Ärzteteams aus dem Ausland reisen an, um bestimmte Krankheiten zu behandeln, für die es im Land sonst kaum Hilfe gibt – Operationen am Grauen Star etwa.
Hebammen und Pflegekräfte als Hoffnungsträgerinnen
 Frisch operiert: Viele Schwangerschaften bringen Komplikationen mit sich, die im weiteren Verlauf zu Schwierigkeiten führen können.Für Studentinnen wie Edia Atanasio ist das eine gute Lerneinheit. Gerade sind besonders viele Frauen da, die an sogenannten Genital-Fisteln leiden. Fisteln sind unnatürliche Verbindungen im Körper, die entstehen können, wenn es Schwierigkeiten bei der Geburt gibt.
Frisch operiert: Viele Schwangerschaften bringen Komplikationen mit sich, die im weiteren Verlauf zu Schwierigkeiten führen können.Für Studentinnen wie Edia Atanasio ist das eine gute Lerneinheit. Gerade sind besonders viele Frauen da, die an sogenannten Genital-Fisteln leiden. Fisteln sind unnatürliche Verbindungen im Körper, die entstehen können, wenn es Schwierigkeiten bei der Geburt gibt. Zum Beispiel, wenn der Kopf des Kindes zu groß ist
, erklärt Tatjana Gerber. Durch den massiven Druck könne das Gewebe zwischen Scheide und Darm oder Blase reißen.
Manche Frauen leben 20 Jahre damit
, erklärt Tatjana Gerber. Die Betroffenen haben Schmerzen, und fast noch schlimmer: Sie müssen Diskriminierung ertragen. Sie gelten als unrein, werden von der Dorfgemeinschaft gemieden. Tatjana Gerber: Die Frauen werden ausgegrenzt. Sie werden zu keiner Feier eingeladen. Sie dürfen nicht in die Kirche gehen.
Entsprechend groß war die Resonanz, als in den Dörfern und Siedlungen Werbung gemacht wurde für die Aktion.
Vor allem über das Radio habe man viele Frauen erreicht, sagt Dr. Jurel Payii, während er eine kurze Pause macht. Er ist aus dem kleinen OP-Saal herausgetreten – der Raum selbst bleibt nur für Patienten und Klinikpersonal offen. Um Fisteln zu behandeln, ist oft eine Operation nötig, man braucht dafür chirurgisches und gynäkologisches Spezialwissen. Für die Sonderaktion sind Ärztinnen aus den USA und Australien angereist. Am Ende werden sie in wenigen Tagen rund 75 Frauen operiert haben. Das Ziel wäre, dass genügend Fachärzte im Land ausgebildet werden, um solche Einsätze selbst durchführen zu können.
Gesundheitsversorgung zwischen Idealismus und Realität
 Die dürftige Ausstattung mancher Klinik kann schockieren.Während die Aktion weitergeht, möchte Dr. Bindu George noch nach einer anderen Studentin sehen. Josephine Emilio absolviert ihre Praxiseinheit in einer Klinik, die vom Staat betrieben wird. Wem die Ausstattung der katholischen Klinik einfach vorkam, den wird die staatliche Klinik schaudern lassen.
Die dürftige Ausstattung mancher Klinik kann schockieren.Während die Aktion weitergeht, möchte Dr. Bindu George noch nach einer anderen Studentin sehen. Josephine Emilio absolviert ihre Praxiseinheit in einer Klinik, die vom Staat betrieben wird. Wem die Ausstattung der katholischen Klinik einfach vorkam, den wird die staatliche Klinik schaudern lassen. Wie geht es Ihnen?
, fragt Bindu George einen Mann, der auf einer blanken Ledermatratze liegt. Ohne Kissen, nur mit einer dünnen Decke. Er trägt noch ein Hemd in Tarnfarben. Wir hatten einen Unfall
, sagt er leise. Ein Militärtransport, der auf der Straße unterwegs war, geriet in eine Kollision. Drei junge Männer kamen ins Krankenhaus, jetzt liegen sie hier, notdürftig verbunden. Sie warten, was weiter mit ihnen geschehen wird. Bitte bringen Sie mir Wasser
, sagt ein anderer Patient. Dr. Bindu George geht an das Waschbecken in einer Ecke des Raumes. Sie dreht am Hahn. Doch es kommt kein Wasser heraus. Sie hat zufällig eine Plastikflasche mit Wasser in der Tasche. Sie nimmt die Flasche und gibt sie dem Mann.
Studentin Josephine Emilio erlebt das jeden Tag. Sie würden gerne helfen, doch die einfachsten Dinge fehlen: Wir hatten keine medizinischen Handschuhe. Ich habe mir selber welche gekauft.
Leere Bettgestelle, ohne Matratzen oder Bettwäsche, ohne Moskitonetze, die eigentlich Pflicht sind. Malaria ist eine der am meisten verbreiteten Krankheiten hier. Josephine seufzt. Sie soll sich nicht entmutigen lassen, redet ihr Bindu George zu: So ist es eben in unserem Land, und wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird.







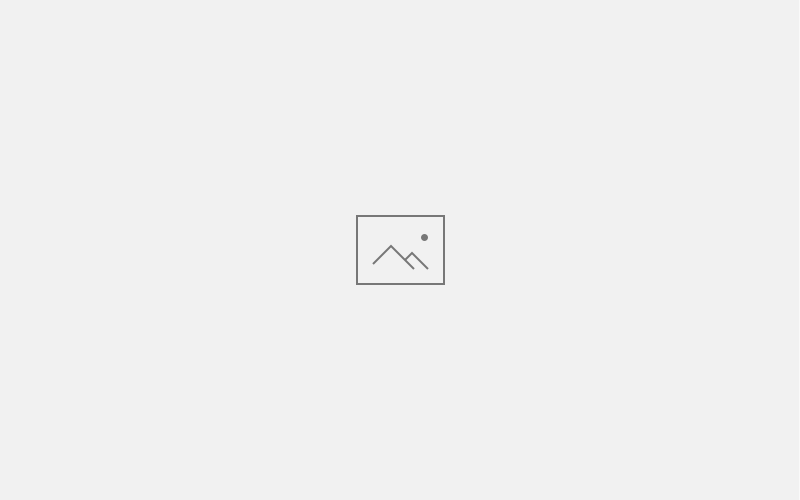






 Zum Afrikatag 2026 nimmt missio mit dem Südsudan ein Land in den Blick, das besonders unter den Auswirkungen von Armut und Krisen leidet. Politische Machtkämpfe werden auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung ausgetragen. Die Gewalt im Nachbarland Sudan bringt viele tausend Menschen als Flüchtlinge ins Land. Wo staatliche Einrichtungen es nicht schaffen, die Menschen zu versorgen, sind es oft Kirchen und Hilfsorganisationen, die einspringen müssen. In kirchlichen Kliniken haben Kranke eine deutlich höhere Chance, gesund zu werden, als in Krankenhäusern der Regierung.
Zum Afrikatag 2026 nimmt missio mit dem Südsudan ein Land in den Blick, das besonders unter den Auswirkungen von Armut und Krisen leidet. Politische Machtkämpfe werden auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung ausgetragen. Die Gewalt im Nachbarland Sudan bringt viele tausend Menschen als Flüchtlinge ins Land. Wo staatliche Einrichtungen es nicht schaffen, die Menschen zu versorgen, sind es oft Kirchen und Hilfsorganisationen, die einspringen müssen. In kirchlichen Kliniken haben Kranke eine deutlich höhere Chance, gesund zu werden, als in Krankenhäusern der Regierung.